 |
|
| |
|
HiFi- und Audio-Seite
![]()
Philosophien / Grundlagen
Ich bin zwar kein High-Ender, benutze jedoch manche Tipps
& Tricks, um den Klang der Anlage zu verbessern.
Andere halten das zwar für Schwachsinn, aber es wirkt und
lässt sich auch physikalisch erklären. Ich versuche mit
möglichst wenig Geld ein Maximum an Klang herauszuholen
und nicht auf Teufel komm' raus, (z.B. mehrere hundert
Mark pro Zentimeter Cinch-Kabel) kompromisslos den Klang
zu maximieren und anschließend darüber zu philosophieren.
Das heißt, dass ich schon Kompromisse eingehe, aber nur
bis zu einem gewissem Grad bereit bin, klangliche
Abstriche zu machen.
HiFi heißt High Fidelity, also hohe Wiedergabetreue, dass
bedeutet, dass das, was die Anlage von sich gibt,
(annähernd) so klingen soll, wie das Original. Es ist in
Normen genau festgeschrieben, welches Gerät sich so nennen
darf, aber einige Hersteller interessiert das anscheinend
nicht. Wenn auf einer Micro-Anlage mit winzigen (Plastik-)
Lautsprechern HiFi dran steht, erfüllt es sicherlich nicht
die Norm. (z.B. DIN) Während heutzutage bei Verstärkern
und digitalen Quellen, wie CD-Playern die
Mindestanforderungen diverser HiFi-Normen spielend
übertroffen werden können, ist das bei Lautsprechern
ungleich schwieriger.
Wer nacheinander seine Anlage durch Komponententausch
verbessern will, sollte an der Quelle anfangen. Ein guter
CD-Player klingt auch durch eine schlechtere Anlage
besser. Aber wer zuerst hochwertige Boxen nimmt, braucht
sich nicht wundern, wenn plötzlich alle Fehler der
gesamten Kette (CD-Player, Verstärker) zu hören sind. Das
heißt auch, dass man keine "Super-Boxen" (mehrere Tausend
Euro) an einen 08/15-Verstärker (wesentlich billiger als
das Lautsprecherpaar) anschließen sollte.
Und wer glaubt, dass das hier alles Schwachsinn ist, muss
das gezielte, richtige Hören erst noch erlernen, der hört
anscheinend auch keinen Unterschied zwischen einer
Mini-Schrott- und einer richtigen HiFi-Anlage. Und wer
sich hochgestylte Design-Anlagen kauft, braucht hier auch
nicht weiter zu lesen. ;)
Das Hauptproblem jeder Anlage sind zuerst die
Lautsprecher: Grund: Übliche Boxen bestehen aus
Mehrwegesystemen, die nach dem dynamischen Prinzip
arbeiten. Problem: aufgrund des Aufbaus und der
Arbeitsweise arbeiten diese Chassis nicht linear. Um einen
einigermaßen konstanten Frequenzverlauf zu erhalten sind
aufwendige (teure) Maßnahmen nötig.
Empfehlungen zu Einzellautsprechern oder Boxen kann man
kaum geben, aber bei richtigen LS-Firmen, wie B&W,
Canton, Infinity, JBL MB-Quart, Quadral macht man weniger
falsch, wenn man nicht das billigste kauft.
Tipps & Tricks zum Verbessern/Maximieren des Klanges:
Wenn man nur einen Tipp probiert, braucht man kein Wunder erwarten. Versucht man aber die Anlage an allen Enden zu optimieren, ist das Endergebnis meist wirklich hörbar besser. Riesenschritte sind damit aber kaum möglich. Das Tunen funktioniert nicht nur bei Home-HiFi-Anlagen, sondern auch teilweise im Car-HiFi-Bereich.
Nicht nur der Kauf der richtigen Komponenten entscheidet über die Originaltreue der Wiedergabe und den Klang. Hier sind nur physikalisch erklärbare Modifikationen erwähnt, andere "Voodoo"-Geschichten (Burn-In, CD-Magnetisierer) fehlen hier. Ziel ist es, hier nur eventuelle Schwachstellen zu minimieren.
1. CDs schwärzen:
Wird als Humbug abgetan, lässt sich aber physikalisch
erklären. Durch das "Bemalen" mit schwarzer Farbe (z.B.
mit Edding) wird Totalreflektion innerhalb der CD
verhindert (oder wenigstens stark reduziert). Sie tritt
auf, wenn Licht aus einem optisch dichteren (geringere
Lichtgeschwindigkeit) in ein dünneres Medium übergeht. Ab
einem bestimmten Grenzwinkel geht der Strahl nicht mehr in
nach außen, sondern wird reflektiert. Da die CD rund ist,
gibt es immer irgendwelche Reflexionen, die die Abtastung
der Pits verhindern. So können Fehler entstehen, so dass
die Fehlerkorrektur aushelfen muss. Weiterhin verringert
sich so der Jitter, eine Störung im Digitalsignal. Auch,
wenn die Abweichungen aufgrund von Bitfehlern eher selten
ist, können sie entstehen, da die Audio-CD-Fehlerkorrektur
nicht übermäßig sicher ist. Die Art der Abtastung (Soft-
und Hardware) erfordert so bei älteren CDs fast generell
eine Fehlerkorrektur. Nach dem Schwärzen der äußeren und
inneren Kanten der Disc (Aufpassen, dass nichts auf die
Abtastseite kommt!) klingt die CD besser und zwar
homogener, wärmer, präziser, weniger steril. So kommt es
zu weniger Fehlern.
Auch Problem-CDs können wiederhergestellt werden. Auf
einer CD hatte ich von Anfang an einen "Sprung" in einem
Titel, den man auf der Disc auch gesehen hat. Da habe ich
sämtliche Flächen und Kanten dieser Scheibe, von denen
nicht gelesen wird, (ausgenommen Beschriftung) geschwärzt.
Seitdem ist sie nie wieder auf dem gleichen CD-Player
gesprungen. Auch mit anderen CDs ist mir das schon
gelungen.
Vorsicht bei Tinte mit Lösungsmitteln! Wenn nicht
unbedingt nötig sollte, die Label-Seite nicht direkt
bemalt werden, da die Tinte die Beschriftung angreifen und
die darunter liegende Aluminiumschicht zerstören könnte!
PS: Ob überhaupt Unterschiede hörbar sind hängt stark von
der CD-Pressung selbst ab, bei einigen war trotz
intensivster Behandlung nichts feststellbar, woanders gab
es (kleine) Unterschiede...
2. Stromversorgung:
Man muss Differenzströme der Gerätemassen untereinander
vermindern. Durch unterschiedliche Netzteile in den
Geräten entstehen Spannungsdifferenzen an den
Gehäusemassen. Diese können z.B. durch Drehen des
Netzsteckers verkleinert werden. Messen mit hochohmigen
(digitalen) Spannungsmesser oder Oszi! Das gilt hier nur
für Netzstecker ohne Schutzkontakt, bei Schuko-Steckern
treten eher Brummströme durch Masseschleifen auf. (Siehe
Punkt 3.) Alle Geräte sollte man außerdem an einer soliden
Steckerleiste anschließen, um die Übergangswiderstände an
den Stiften zu minimieren. Die Ausgleichspannungen werden
zwar durch die Abschirmung der Cinch-Kabel praktisch
kurzgeschlossen, aber die dadurch entstehenden Ströme
"behindern" den Signalfluss. Die Spannung ist ein Gemisch
aus mehreren Wechselspannungsfrequenzen mit einem
DC-Offset. Weiterhin kann das Stromnetz selbst durch
Netzfilter o.ä. bereinigt werden. Diese entfernen
Oberwellen und Störfrequenzen über 50 Hz, um möglichst nur
diese Sinusschwingung durchzulassen. Auch das Verwenden
von Ferritmanteln um die Netzleitung ist so bereits
hilfreich. Inwieweit jedoch diese Maßnahmen
klangverbessernd wirken, ist stark von den Bausteinen und
der Sauberkeit des Netzes abhängig, es kann nicht hörbar
sein oder eine minmale Verbesserung erzielt werden. Aber
Wunder sollte man nicht erwarten! Auch bei symmetrischer
Verkabelung (XLR-Stecker) sind diese Hinweise sicher
nützlich, auch wenn man hier keine Verbesserungen erwarten
sollte, da über die Masseleitungen und Abschirmungen keine
Signale übertragen werden. Denn eine Einstrahlung von der
Masse auf die heißen Adern ist möglich, jedoch löschen
sich diese beiden Signale aufgrund der nachfolgenden
Differenzeingangsstufe wieder aus.
3. Brummschleifen:
Die Masse/Erde an den Gehäusen stellt immer ein Problem
dar, sobald das Erden an mehreren Punkten oder an mehreren
Geräten gleichzeitig geschieht. Da die Zuleitungen von
Antennen und Kabelfernsehen und -Radio geerdet sind,
treten so meist starke Störgeräusche (Brummen) auf. Grund
für die Erdung ist der Blitz- und Berührungsschutz
(Vorschrift) und die bessere Abschirmung. So entstehen oft
Brummschleifen durch die Kombination von geerdeter
Endstufe mit einem Tuner. Diese können verhindert werden,
indem man einen Mantelstromfilter (angepasster
HF-Transformator, der etwa 10 Euro kostet) in die
Antennenleitung klemmt. Solche gibt es bei fast jedem
Elektronikhandel, wie auch bei Conrad.
Manchmal hilft schon je ein Kondensator (z.B. Scheiben-C
von 4,7 nF) in der Masse- und einen in die Signalleitung.
(entsprechend Hochpass im MHz-Bereich)
Bei Satellitenreceivern funktionieren diese Möglichkeiten
nicht, da zusätzliche Informationen (z.B. durch 14V/18V -
Gleichspannung-Polarisationsumschaltung und
22-kHz-Schaltfrequenz b.z.w. DiSEqC-Informationen) mit
über die HF-Leitung übertragen werden. Meines Wissens gibt
es dafür bis jetzt noch keine industrielle Lösung, so dass
hier wieder die Eigenentwicklung herhalten muss. Das
notwendige Gerät ist aber nicht allzu simpel, besonders
wenn DiSEqC-Daten übertragen werden sollen. Ist nur die
Polarisationsumschaltung (14/18 V) nötig
(Standard-Analog-LNB) hält sich der Aufwand jedoch in
Grenzen (<30 Euro).
Da meist aber der Sat-Receiver / Fernseher mit der Anlage
verbunden ist, hilft hier meist keine galvanische Trennung
im NF-Bereich. Auch klanglich ist eine galvanische
Trennung im HF-Bereich immer empfehlenswerter als der
Versuch es an den NF-Kanäle zu trennen, da so der Phasen-
und Amplitudenverlauf praktisch nicht beeinflusst wird,
wenn das Signal noch moduliert vorliegt.
Vor allem bei Schallplattenspielern sollte ein dickes
zusätzliches Massekabel zum Vorverstärker gezogen
werden, um hier das Eingangsbrummen deutlich zu
reduzieren. Ein Massekabel kann man vom Verstärker
evtl. auch zu anderen Komponenten ziehen.
Oft brummen PC-Soundkarten, die an der Anlage
angeschlossen werden, dann sollte man es damit versuchen:
Antennenstecker vom Tuner abziehen. Sollte das erfolgreich
sein, den schon beschriebenen Mantelstromfilter einsetzen.
Es ist auch möglich, entweder die Erde vom Rechner zu
entfernen (nach VDE-Richtlinien nicht zulässig!) oder eine
Galvanische Trennung zwischen Anlage und Rechner schalten.
Meine Empfehlung wäre dann aus dem ELV-Katalog
die Cinch-Trennung mit zwei Linear-Opto-Kopplern. Es
handelt sich um einen Bausatz für ca. 25,- Euro aus Heft
3/99 (Bestellnummer 53-369-01) sowie dem zugehörigen
Gehäuse (53-369-29) für ca 8,- Euro. Er erfüllt zwar keine
High-End-Bedingungen, übertrifft aber diverse HiFi-Normen
(Klirr 0,05%, Frequenzbereich +-1 dB <20 Hz...>40
kHz) bei weitem und so auch die Ausgabequalität von
Standard-Soundkarten des unteren bis mittleren
Preissegmentes (<150 Euro). Weiterhin sollte man den
Computer und die Anlage an den gleichen Netzverteiler
anschließen und lange Kabel vermeiden. Sollten diese
Maßnahmen nicht erfolgreich sein, siehe auch Punkt 9.
Tritt Brummen durch die Masseverbindung von digitalen
Verbindungskabel auf, sollte man es mit dem optischen Ein-
und Ausgang versuchen, da dem Lichtleiter solche Probleme
fremd sind. Fehlt ein Anschluss, hilft ein Umwandler von
koax auf optisch und umgekehrt weiter. Diese sind
preiswert zu erstehen. Selbst die teuersten High-End-Teile
mit Jitter-Korrektur etc. kosten unter 200,- EUR, so dass
für den Normalgebrauch Geräte im Bereich bis etwa 20,-
Euro ausreichen. Es sei denn, man will selber das Teil
selber bauen, die Bauteile kosten etwa 10,- Euro.
(Schaltungen sind auf dieser Seite.)
Komplette Bausätze sind dafür sicher auch erhältlich. Sind
keine optischen Verbinder möglich, empfiehlt sich
folgendes: Einen TTL-Umsetzer mit einem breitbandigen
Optokoppler (Bandbreite ca. 10 MHz) benutzen und
davor/danach die Pegel auf SP/DIF anpassen. Schaltung und
Beispiel auf dieser Seite
4. Kabel:
OK, ich muss eins vorwegschicken, wer erwartet, dass Kabel
für 100,- Euro-Kabel gegenüber 10,- Euro stark hörbare
Unterschiede bringt, muss enttäuscht werden. Die
Unterschiede sind nur marginal. Man sollte nur nicht in
Extreme verfallen, d.h. keine Mini-Strippen (0,5 mm²)
verwenden, aber auch nicht ein Riesen-Geld (2000 EUR)
ausgeben.
Bessere Cinch- und Lautsprecher-Kabel (von Stinknormal auf
z.B. Kimber-Cable) bringen dennoch Unterschiede. Oft als
Blödsinn abgetan, lässt sich dieser Unterschied auch
physikalisch durch die Leitungstheorie erklären.
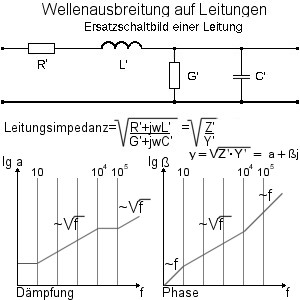
Die ideale Leitung würde keinen ohmschen Längswiderstand, keine Kapazität, Induktivität und Ableitungsleitwert besitzen. Deshalb sollte das Kabel so kurz wie möglich sein. Dabei sollten aber die Kabel für den linken und den rechten Kanal die gleiche Länge besitzen. Es existieren auch vorkonfektionierte Kabel, die einen nachgeschalteten Filter, einen so genannten Terminator verwenden, um die Leitungsparameter auf ein ideales Maß zu ziehen.
Jedes Kabel besitzt unterschiedliche Leitungsparameter. Neben den Abmessungen, der Form ist auch das Material wichtig.
Kimber-Kabel (oder andere verflochtenen) klingen
besonders im Hochtonbereich besser, da u.a. die
Leitungsinduktivität verringert wird.
Und in jedem Kabel fließt der Strom nicht nur in eine
Richtung. Es entstehen an den Kabelenden und Verbindungen
(Impedanzänderungen) Reflexionen, die Verfälschungen
hervorrufen. So ist Anpassung eine wichtige Voraussetzung.
Dadurch klingt meist jedes Kabel nicht an allen Geräten
gleich gut oder schlecht. Je nach Leistung sollten die
Kabel nicht zu dünn sein. Bei einem 200-W-Subwoofer sollte
es doch schon minimal 4 mm² (Quadratmillimeter)
Querschnitt besitzen. Bei normalen Frontboxen (ca. 120 W
an 4 oder 8 Ohm) reichen etwa 2,5 mm². Im PA-Bereich ist
es besser mehr. Dort werden größere Leistungen und
Kabellängen, bei gleichen Impedanzen verwendet. 8 Ohm
Lautsprecher reagieren auch nicht so kritisch auf
Kabellängen wie welche mit 4 Ohm Impedanz. Allein der
ohmsche Anteil der Leitung vergrößert die Güte und
verschlechtert damit die Präzision der Boxen.
Lautsprecherkabel verwenden, bei denen man die
Polarität sehen kann, um sie phasenrichtig
anzuschließen.
Bei Cinch-Kabeln ist auch die Kabel-Abschirmung bei hohen
Eingangsimpedanzen (im Kiloohm-Bereich) wichtig, um
Fremdsignale und Rauschen zu minimieren. Das ist bei
Kimber-Cable ein gewaltiger Nachteil. Da es keine
Allheilphilosophie im EMV-Bereich gibt, hilft meist nur
probieren. Aber die Praxis zeigt meist, dass Kabel mit
doppelter Schirmung, bei denen der obere Schirm einseitig
geerdet wird, ein gutes Ergebnis liefern, wenn man
Fremdeinstrahlung fern halten will. (sie sind deshalb im
Car-HiFi-Bereich Pflicht) Noch besser wird es, wenn das
Kabel keinen koaxialen Aufbau hat, sondern 2 verdrillte
Innenleiter (Twisted Pair). Verstärkereingänge werden
meist etwas hochohmiger ausgelegt, um Ausgänge von "nicht
ganz so niederohmigen" Signalquellen (wie früher bei
DIN-Anschlüssen) nicht zu stark zu bedämpfen damit der
Pegel stimmt. Dies erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit
für das Einfallen von den Störungen.
Lesertipp:
Für die Verbindung von Vor/Endstufen-Kombis auf die
Ausgangsimpedanz der Vorstufe achten. Niemals an eine
Röhrenvorstufe (z.B. Impedanz 2 kOhm) ein hochkapazitives
Kabel klemmen. Die Konsequenzen für die
Übertragungsbandbreite sind verheerend. Lieber niedrige
Kapazität und höhere Induktivität wählen.
Es gibt auch Korrektureinheiten (z.B. fadel-art Typ MB10)
Diese werden in die Leitung geschleift und nehmen eine
Impedanzanpassung sowie Laufzeitkorrekturen vor.
Bei Digital-Kabeln sieht das alles etwas anders aus. Man
könnte ja meinen, dass bei digitalen Übertragungen über
Kabel keine Fehler möglich sind. Vor allem Jitter
beeinflusst hier die nachfolgenden D/A-Wandler negativ.
Weiterhin definiert man für einen Übertragungskanal eine
Bitfehlerrate, die sagt, nach welcher Zeit statistisch ein
falsches Bit übermittelt wird. Deswegen existieren ja
Fehlerkorrekturen, die aber bei unterschiedlichen Kabeln
unterschiedlich oft zum Einsatz kommen. Und rein digitale
Daten werden elektrisch nicht übertragen, es sind immer
digital modulierte (analoge!) Spannungen. Und bei SP/DIF
sind sie dazu noch relativ gering, die
Low-High-Pegelunterschiede liegen bei nur etwa einem
halben Volt. Deshalb sollten diese Kabel möglichst kurz
sein. Aus diesem Grund werden im Studiobereich (AES)
höhere Pegel (+-5 V) eingesetzt.
Koaxiale Ein-/Ausgänge haben einen festgelegten
Abschlusswiderstand von 75 Ohm. Wird also ein hochwertiges
75-Ohm-Kabel mit sicheren und passenden Verbindungen
benutzt, entstehen keine nennenswerten Reflexionen und
wenn das Kabel noch eine geringe Kapazität und
Induktivität hat, werden hohen Frequenzen nur gering
gedämpft, so dass auch HF-Signale übertragen werden
können. Der Datenstrom (CD-Format) von etwa 1,4 Mb/s = 175
kB/s setzt (bei einwertiger Impuls-Übertragung) eine
Frequenzbandbreite von theoretisch mindestens 700 kHz
voraus. Allerdings wird das Digitalsignal moduliert, um
keine Gleichspannungsanteile übertragen zu müssen. Die
Abtastrate liegt je nach Samplingfrequenz zwischen 2...3,1
MHz. Laut Norm (SPDIF) ist eine Übertragungsbandbreite von
100 kHz bis 6 MHz notwendig. Dies ist bei hochwertigen,
nicht extrem langen Video-Kabeln (analoge Videosignale
erfordern ein Minimum von 5,5 MHz.) gegeben. Da die
Digital-Surroundverfahren ähnlichen Datenraten wie SPDIF
haben (zwischen 320...1536 kb/s), kann man so ebenfalls
diese Kabel dafür einsetzen. Da die Daten dann praktisch
kaum noch verfälscht werden, ändert sich nichts am Klang.
Also gibt es theoretisch keine hörbaren Unterschiede auf
diesem Signalweg. Also sind hochpreisige (>30,- Euro)
Digital-Koax-Kabel meiner Meinung nach überflüssig. Gute
Cinch-Videokabel (z.B. Standard-Kabeltyp RG59) sind hier
ein hervorragender Ersatz und auch preiswert. Koxiale
HF-Antennen-Kabel, auch wenn sie einen Wellenwiderstand
von 75 Ohm haben, eignen sich jedoch nicht immer so sehr
dafür, wie ein Test zeigte. Diese sind anscheinend
optimiert für sehr hohe Frequenzen (10 MHz...1 GHz) und
haben im unteren, aber entscheidenden Frequenzbereich
Defizite.
Bei optischen Digital-Kabeln entstehen genau aus den
gleichen Gründen Reflexionen, wie bei den koaxialen aus
Kupfer. Hier entspricht eine Impedanzänderung eine
Änderung des optischen Widerstandes. Ein optisch dichteres
Medium hat eine geringere Lichtgeschwindigkeit als in
dünneren Medien. Dieser Widerstand kann mit geeigneten
Faserwerkstoffen und guten Verbindungen (Stecker,
Faserübergänge) minimiert werden, ist jedoch entsprechend
teuer. Normalerweise sind erst bei größeren Leitungslängen
andere Faserwerkstoffe, wie richtige Glasfaser statt den
sonst meist verwendeten Kunststoffen nötig. Die
Übertragung findet bei Kunsstoffleitern im roten, bei
reinen Glasfasern im infraroten Bereich statt. Deshalb
hilft es meist nichts, richtige Glasfaser an optische
Toslink-Buchsen zu verwenden. Hier gilt: die
normalen Kunststoffleiter, die an
TOSLINK-Buchsen benutzt werden sollten zur sicheren
Datenübertragung so kurz wie möglich sein. Laut
Herstellerangaben (Toshiba) liegt die maximale Datenrate
bei 6 MBit/s und die größte Leitungslänge dabei bei ca.
6...10 m. Um eine sichere Übertragung zu gewährleisten,
müssen die LWL genau aufeinander liegen und plan sein,
sonst kommt es sofort zu Dämpfungen. Deshalb empfiehlt es
sich hier z.B. Stecker mit flexibel gelagerter
Metallspitze zu verwenden.
Da an offenen Ausgängen (siehe 3.) Reflexionen auftreten,
ist es sinnvoll, diese abzuschließen (zu terminieren). Bei
koaxialen also mit einem 75 Ohm Widerstand, den man in
einen Cinch-Stecker einlötet oder crimpt. Der Widerstand
sollte möglichst klein sein, um die Induktivität so klein
wie möglich zu halten (Metallfilm: 1%). Auf keinen Fall
Drahwiderstände einsetzen! Auch sollte durch die
Ausgangsspannung von etwa 1.6 Vss eine Leistung des
Widerstands von 35 mW nicht unterschritten werden. Bei
optischen Ausgängen ist das schwarze Einsteckteil Pflicht,
um die LED zu schützen. ;)
5. Verbindungen mit Gold-Steckern:
Sie sehen nicht nur edler aus, sie haben die Funktion des
Minimierens der Übergangswiderstände. Bei Verbindungen mit
z.B. Kupfer,... (und Legierungen) ist der Widerstand zwar
gering, er steigt jedoch schon nach einigen Wochen auf ein
Vielfaches! Bei Gold tritt dieser Effekt nicht (so stark)
ein. Gold hat einen etwas höheren spezifischen
elektrischen Widerstand als Kupfer, aber er verändert sich
nicht durch Oxydation. Und das Gold wird nur ganz dünn
aufgedampft, so dass der elektrische Widerstand bei
weniger als 0,1 mm vernachlässigbar klein ist. Theoretisch
sollte die Verbindung zwischen Kabel und Stecker immer
durch Crimpen entstehen, da es hier die geringsten
Übergangswiderstände gibt. Verzinnen ist zwar eine relativ
sichere Kontaktierung, hat aber einen höheren
Übergangswiderstand. Bei flexiblen Kabeln kommt noch der
Nachteil des Aushärtens, der zu Kabelbrüchen hinter der
Lötstelle führt, wenn das Kabel bewegt wird. Deshalb im
Auto immer crimpen und nicht löten!
Das Material mit dem niedrigsten spezifischen elektrischen
Widerstand ist Silber (Ag), nur marginal (10%) schlechter
ist Elektrolyt-Kupfer.
Bei Lautsprecherverbindungen sieht es ähnlich aus, deshalb
haben hochwertige Lautsprecherboxen vergoldete Terminals,
an denen die Kabel direkt oder mit Aderendhülsen
eingeklemmt werden.
6. Spikes:
Sie bewirken, wie auch eine große Masse einen stabileren
Stand der Boxen und HiFi-Komponenten. Lautsprecher
verursachen durch die Membranschwingungen
Taumel-Bewegungen (actio = reactio) der Box, die die
Wiedergabe der Lautsprecher stören. Besonders starke
Bass-Schläge lassen die Box minimal schwanken. Diese
kleinen Bewegungen bewirken einen unpräziseren
Tieftonbereich. Aber auch der Hochtonbereich wirkt
anstrengender und nicht so harmonisch, da den hohen
Frequenzen die tiefen aufmoduliert werden.
Bei der Anlage bewirkt der stabilere Stand bei
mechanischen Geräten (Plattenspieler,
CD/DVD/BluRay-Player, Kassettendeck ...) ein ungestörteres
Einlesen der Informationen und so eine bessere Wiedergabe.
Bei Verstärkern, Tunern, Vorstufen ... wirkt, meiner
Ansicht nach, auch der Abstand zu den benachbarten
Geräten. Der Abstand reduziert Einstreuungen (vor allem
magnetische Felder) auf die Geräte untereinander. Das
sorgt für ungetrübteren Klang. Elektrische Felder lassen
sich durch Metall relativ gut abschirmen, magnetische
Felder jedoch nur schwer.
Aber es gibt auch einen Einfluss der Bewegung von anderen
Komponenten auf den Klang, über die Stärke dieser
Mikrofonie-Auswirkungen kann man spekulieren. Deshalb gibt
es auch spezielle HiFi-Racks, die Spikes,
Quarzsand-gefüllte, stabilen Rohren und schwingungsarme
"Platten" besitzen. Unterschiede aber heraus zu hören ist,
wenn überhaupt, dann sicher nur mit Anlagen jenseits der
10 000 Euro möglich.
Aber selbst die Temperatur und der Luftdruck in den
Komponenten haben einen Einfluss auf die Qualität der
Wiedergabe. Deshalb werden die Weichenbauteile von
High-End-Lautsprecherboxen auch vergossen und sie befinden
sich außerhalb des Luftvolumens der Lautsprecherchassis.
Obwohl sich die TS-Parameter der Lautsprecher abhängig von
der Leistung (Temperatur) verändern, kann man das hier
kaum verhindern.
Deshalb müssen auch Verstärker etc. warm laufen, da die
Bauelemente auf Betriebstemperatur ausgelegt wurden.
7. Lautsprecheraufstellung:
Nur Probieren hilft, um den optimalen Ort für sie zu
finden. Aber Aussagen zu Grundtendenzen sind bereits
möglich. Lange kahle Wände, wenig Möbel, harte Fußböden
(ohne Teppich etc.) das sind Basskiller! Eckenaufstellung
der Boxen bewirkt zwar ein Verstärken des Bassbereichs,
der Pegel ist jedoch stark standortabhängig, und der Bass
wird unpräzise. So ist zum Beispiel genau in der Mitte des
Raumes meist kein Bass, da sich durch die Wände die
ziemlich langwelligen Schalle (5...20m) auslöschen.
Dämmung des Raumes hilft. Man muss versuchen den optimalen
Kompromiss zwischen kahlen Wänden (New Art-Wohnungen) und
stark gedämpften Räumen (wie z.B. Omis Wohnzimmer) zu
finden. Auch wird durch einfaches Verstärken des Basses
(auch am Verstärker) dieser unpräzise und dröhnig, was
nicht gerade erstrebenswert ist. Was hilft es, wenn der
Bass an einer Frequenz zwar laut ist aber nur dröhnt - Das
hat nichts mit HiFi zu tun, das ist Krach! (Wird der
Schall an einer Wand optimal reflektiert, ergibt das
ein Gewinn von 3 dB, bei einer Ecke sind so theoretisch
bis zu 9 dB drin. Aber nicht alle Frequenzen werden gleich
verstärkt.) Achtung bei speziell angepassten Lautprechern,
wie z.B. Eck-Hörnern, die um Austrittsfläche zu sparen, in
die Ecke gestellt werden müssen, da man die Zimmerwände
mit nutzt.
Zur richtigen Ortung müssen bei konventionellen
Lautsprechern beide gleich weit entfernt sein, um die
optimale Räumlichkeit zu erreichen. (Stereodreieck) Vor
allem Omnipolar-Systeme erweitern dieses Bereich.
Auch sollten die Lautsprecher nicht zu nah an Wänden und
Möbeln stehen, um richtig zu klingen. Aber nicht jede Box
eignet sich für jeden Raum und so sind auch die sinnvollen
Wandabstände bei jeder Box anders. Bei den meisten Boxen
sollte der Abstand zu Wand oder Möbeln mindestens 40...50
cm betragen.
Noch ein Tipp für Nutzer von analogen DOLBY
SURROUND: (egal ob Matrix-, Simple- oder
Pro-Logic-Decoder) Die beiden hinteren Lautsprecher
gegeneinander verpolen um ein diffuses Klangbild zu
erzeugen. Also einen der beiden Lautsprecher verpolt
anschließen und beide nicht zu weit auseinander stellen.
Dies ist äußerst sinnvoll, besonders wenn man hinten nicht
über Dipolstrahler verfügt. Das gilt nicht für THX, Dolby
Surround PL II und Mehrkanal-Digitalsysteme.
8. Komponenten: (Warnung, Garantie erlischt, nur
von Fachleuten durchzuführen)
Man kann nicht nur die Verbindungen etc. zwischen den
einzelnen Komponenten, sondern auch die Komponenten selbst
optimieren, so dass sie zur Hochform auflaufen. Das ist
besonders bei Geräten des oberen Mittelklasse-Segments,
bei denen die Garantie (meist 1 Jahr) bereits abgelaufen
ist, zu empfehlen.
- Das "Tunen" kann am einfachsten durch das Verbessern der Stromversorgung in den Geräten geschehen. Bessere Innenverkabelung ist besonders bei Verstärkern eine sinnvolle Möglichkeit, um noch mehr aus ihnen herauszuholen. Manche Leute entfernen sämtliche Ausgangs-Relais und Schutzvorrichtungen aus ihren Verstärkern, um noch ein Quäntchen (Klang keine Leistung!) mehr herauszuholen. Hilft zwar, aber Vorsicht! Ein ausgangsseitiger Kurzschluss zerstört sofort die teuren Endtöpfe! Sonst hilft noch ein Austausch der Ausgangsrelais gegen Modelle mit geringerem Innenwiderstand. Optimal sind hier vergoldete Kontakte oder mit einem Schutzgas. Die Komponente ohne Schutz sollte man nicht verborgen und sicher anschließen. Jede Verringerung des Innenwiderstandes am Verstärkerausgang wirkt sich klangverbessernd aus, weshalb in höherpreisigen Geräten auch mehrere (meist 2...10) Endstufentransistoren parallel geschaltet werden.
- Besonders Verstärker (aber auch andere Komponenten) spielen noch einmal freier und schöner, wenn man ihnen zusätzliche Elkos (Elektrolytkondensatoren) und Folienkondensatoren für die Stromstabilisierung spendiert. Dabei ist auf die zulässige Maximalspannung der Elkos achten! Viel hilft viel, und mehrere kleinere sind besser als ein großer, da sie durch die Parallelschaltung einen geringeren Innenwiderstand besitzen. Dadurch wird die Versorgungsspannung zusätzlich stabilisiert, das heißt, dass auch die Ausgangsspannungen näher an den Sollwerten liegen, besonders bei steigenden Ausgangsleistungen. Im Einzelfall kann dieses Aufrüsten zu Problemen führen, da die Einschaltströme dadurch ebenfalls ansteigen.
- Auch für CD-Player und DA-Wandler empfiehlt es sich die Stromversorgung mit fetten Elkos zu stabilisieren. Zusätzlich machen sich kleine MKT-Kondensatoren (z.B. 220 nF) vor und hinter den Spannungsreglern positiv bemerkbar. Sie sorgen für eine weitere Unterdrückung aufmodulierter Hochfrequenz aus den Digitalbaugruppen.
- Koppelkondensatoren zwischen den Analogstufen werden
oft als Elkos ausgeführt, deshalb sollten sie durch ein
Folien-C (z.B. MKPs, Zinnfolie), etwas höherer Kapazität
ersetzt werden, um diese klangliche Unzulänglichkeit
verschwinden zu lassen. Sollte das aufgrund der Größe
(>10 µF bei niederohmigeren Eingangswiderständen der
nachfolgenden Stufe) nicht möglich sein, hilft es oft
schon, wenn man Folienkondensatoren parallel schaltet.
Elkos im Signalweg sind immer ein Kompromiss, da diese
u.a. schon einen Gleichspannungs-Offset benötigen, um
richtig zu funktionieren und hochfrequenten Strömen
einen anderen Widerstand entgegensetzen als ein
konventioneller Folien-Kondensator. Es gibt selbst bei
den Folien-Cs Unterschiede, je nach Metallsorte,
-Oberfläche und Dielektrikum-Material.
- An Verstärker-Eingängen sind zur HF-Einstrahlfestigkeitsverbesserung Kondensatoren nach Masse geschaltet, die begrenzen aber die Bandbreite. Entfernt man diese Kapazitäten verbessert sich das Impulsverhalten, die Räumlichkeit und die Darstellung von Feinheiten im Obertonbereich. Auch Stimmen klingen besser, es verschwindet eine gewisse Rauigkeit. (Tipp eines Lesers)
- Weiterhin hilft es, die Bauteile gut zu befestigen, statt sie frei schwingen zu lassen (Mikrofonie-Einflüsse) Das trifft auf Kondensatoren (auch Elkos) genauso zu wie auf den Netztrafo, der immer verklebt sein sollte. Ein guter Netztrafo (am besten mit Ringkern) ist immer eingegossen, um jede Schwingung so stark wie möglich zu bedämpfen.
- Will man einen älteren CD-Player tunen, kann man die Abtastung noch einmal verbessern, indem man erstens die Fotodiode in einem besseren Arbeitspunkt betreibt. Dies gelingt durch eine daneben angebrachte (blau soll angeblich optimal sein) LED, die einen Offset auf die Fotodiode bringt. Die Spannungsversorgung (DC) der LED muss hervorragend stabilisiert und sauber sein, damit sie nicht flackert, auch wenn es nicht sichtbar ist. Das Ergebnis ist neben dem besseren Klang zusätzlich ein besserer Rauschabstand des Players. Dies ist besonders sinnvoll, wenn man nur das Laufwerk, nicht aber den DA-Umsetzer, also neben dem Player zusätzlich einen externen Wandler verwendet. Wenn man vom Playerinneren möglichst viel Fremdlicht fern hält, ist man dann auch immer auf der sicheren Seite.
- Wer weiter gehen will, kann auch Bauteile ersetzen.
Billige Standard OPVs wie den beliebten Doppel-OPV
NE5532 durch schnellere Burr-Brown OPA2604 oder gute
Alternativen von Analog Devices austauschen.
(Leser-Tipp)
- Auch lassen sich preiswertere Lautsprecherboxen optimieren, indem man billige Weichen mit besseren Bauteilen bestückt, oder die Abstimmung verändert, z.B. die Güte der einzelnen Zweige verkleinert. Ein Probe hören ist aber nötig, ein Nachmessen wäre noch besser.
9. Störeinstrahlung (vor allem bei PCs):
Obwohl in den CE-Normen sehr genau geregelt ist, was wie
stark streuen darf, wird es besonders im Computerbereich
oft vernachlässigt. Kommen zum Beispiel die Störgeräusche
von der Soundkarte selbst, ist oft Not am Mann. Hier hilft
z.B. ein Umstecken der Soundkarte im Rechner. Also diese
ganz nach unten und die Grafikkarte ganz nach oben: Das
hilft sehr oft, da heutzutage besonders die hoch
getakteten Grafikbeschleuniger "streuen". Zusätzlich kann
man auch die Soundkarte zusätzlich abschirmen, indem man
Alufolie beidseitig mit Papier oder Pappe beklebt und
diese links und rechts neben der Soundkarte befestigt. Die
Metallfolie darf keine Verbindung zu den Anschlüssen
haben. Dann sind die Alufolien noch mit der Masse des
Rechners (Gehäuse) zu verbinden. Und, wenn möglich, evtl.
interne Verstärker abschalten, die rauschen nur...
ITuning: Meine alte Terratec Maestro 32 wurde vom
überflüssigen Ballast, wie dem billigen Lautstärkepoti und
den internen Zusatzanschlüssen (Stecker für Line in/out
etc.) befreit. Dabei ist zu beachten, dass die
Durchkontaktierungen erhalten bleiben und Festwiderstände
als Abschluss am Ausgang eingelötet werden sollten. Auch
eine zusätzliche Bereinigung der Stromversorgung auf der
Karte hilft weiterhin. So kann man den SNR noch einige
Dezibel nach oben zu treiben, im gesamten Frequenzbereich
von 20 Hz...20 kHz (+-1,5 dB).
Aber auch im "normalen" HiFi-Komponenten sind
Einstrahlungen problematisch. Deshalb sind gute solide
Metallgehäuse (kein Plastik-Müll) hierbei Pflicht.
Verbesserte Isolation der (elektrischen und magnetischen)
Strahlung von anderen Teilen des Geräts kann dem Klang auf
die Sprünge helfen. Das fängt beim Trafo und dem gesamten
Netzteil an und hört bei den empfindlichen Eingangsstufen
auf, besonders bei den Phono-Eingängen.
10. Digitale Kopien:
Beim CD-Kopieren ist einiges zu beachten. SONST KÖNNEN
CD-KOPIEN STÄRKER RAUSCHEN UND KNACKSEN. Von den Sprüngen
u.s.w., die ich bei einigen gebrannten schon gehört habe,
will ich gar nicht reden. Kopierschutz?
Das Einlesen der Audio-CD wird hierbei immer unterschätzt.
Hier meine ich insbesondere PC-Laufwerke, aber auch
billige HiFi-Brenner. Hier ist ein hochwertiges Laufwerk
Pflicht, das Digital Audio-Streaming unterstützen muss,
nur so hat man die Grundlage für echte 1:1 Kopien.
Siehe auch Tipp 13)
Das CD-Laufwerk sollte, um absolut sichere 100-%-ige
Kopien zu erstellen, noch ausgebremst werden, ich empfehle
z.B. 8-fach-Speed. (Das würde z.B. das Lesen einer
Sampler-CD immer noch unter 10 Minuten und das eines
Albums unter 5 Minuten erlauben, das reicht doch!) Ein
Auslesen mit mehr als 12-fach-Speed kann ich (vor allem
bei älteren CDs oder gar CD-Rs) nicht empfehlen.
Wer anfängt die analogen Ausgänge des CD-ROMs und die
Soundkarte zu verwenden, kann das sein lassen, die
Qualität liegt noch unter der, von guten
HiFi-Kassettendecks. Die Digitalausgänge des CD-ROMs an
die Digital-Eingänge der Soundkarte anzuschließen ist eine
Notlösung, die aber bei guten Komponenten und tadellosen
CDs funktioniert. Eine bessere Alternative ist dabei
jedoch eine hochwertigere Soundkarte mit Digitaleingang
und ein externer HiFi-CD-Player, der über seinen
Digital-Ausgang mit der Karte verbunden wird. (Das erlaubt
auch legale Kopien von kopiergeschützten CDs.)
Das Einlesen über ein CD-Laufwerk erfolgt ohne
Komprimierung auf die Platte, um da zur Not nachbearbeitet
zu werden. Hier meine ich nur Maximieren / Normalisieren
auf 99% und das Schneiden, wenn man Stücke von
verschiedenen CDs nimmt. Equalizer, Surround-Funktion und
anderer klanglicher Schwachsinn sind bei heutigen
Aufnahmen überflüssig.
Meine Empfehlung für die Einlesesoftware ist AudioGrabber
oder ExactAudioCopy und der sektorsynchronisierte
Modus, der dauert zwar, abhängig vom Laufwerk
noch einmal bis etwas länger, ist aber besser und bei
trackübergreifenden Stücken (z.B. Live-Alben) sogar
Pflicht, um die Titelübergänge korrekt einzulesen. Sonst
kommt es zu Knacksern oder Aussetzern beim Übergang. Da
das Programm sehr harwarenah arbeitet, ist während des
Einlesens auf andere Arbeiten am Rechner zu verzichten. So
ist auch das ganze automatische Energie- (Standby,
Screensaver etc.), Virenscanner- und Datenorganisations-
Management, also aller überflüssiger Schrott im PC, vorher
abzuschalten, sonst kommt es eventuell zu
Synchronisationsproblemen. Beim AudioGrabber ist im
allgemeinen die Dynamic Sync-Width-Methode der beste Modus
zum Einlesen, das ist aber abhängig vom Laufwerk.
Als Brenner ist ein Markenbrenner empfehlenswert. Große
Unterschiede kann ich dann dabei nicht bestätigen. Wichtig
sind hier noch die CD-Text-Option und zum Erstellen von
CD-Kopien die RAW-Fähigkeit. Ich empfehle beim Brennen von
Audio-CDs die diversen Pufferleerlaufschutz-Verfahren
(Burn-Proof etc.) abzuschalten. Nur so erhält man
einwandfreie CD-Rs.
Audio-CDs werden immer komplett im Modus: "Disk
At
Once" und nicht "Track At Once" gebrannt,
sonst kann Knacksen zwischen den Titeln entstehen.
Zur Brenngeschwindigkeit kann ich sagen: Je geringer,
desto besser. Ich würde besonders bei Audio-CDs nie mehr
als 4 oder 8fach brennen empfehlen. Einige Tests haben
bestätigt, dass sogar bei Daten-CDs, die obwohl mit dem
gleichen Markenrohlingtyp (TDK) 4-fach gebrannt wurden, in
normalen (RW-fähigen) 48x-CD-ROMs langsamer ausgelesen
werden konnten als die in Single-Speed gebrannten. Die
Kontur der Pits auf der Oberfläche ist im allgemeinen
akkurater, wenn man langsamer brennt. Das hängt aber auch
vom Rohling ab, manche haben bei niedrigen
Geschwindigkeiten eher Probleme, wenn sie auch für z.B.
48x freigegeben wurden.
Ob es Qualitätsunterschiede der gebrannten Audio-CDs
zwischen diversen Brennprogrammen gibt, kann ich nicht
eindeutig sagen. Ich glaubte das zwar zuerst nicht, aber
(z.B. bei Feurio) hatten schon mal einige Audiotracks
Datenmüll enthalten.
Man sollte keine billigen Rohlinge (z.B. Noname)
verwenden. Das hat auch einen guten Grund, da der Brenner
bei solchen CD-Rs oft nicht mit korrekten Einstellungen
(Brennleistung) brennt. Nur Markenhersteller garantieren
auch die Langlebigkeit der CD-Rs. So hatte ich schon
einige Scheiben (Koch, Traxdata), die nach einigen Monaten
nicht mehr sauber gelesen werden konnten. Im allgemeinen
kommen die meisten CD-Player am besten mit stark
reflektierenden Gold-Rohlingen zurecht. Einer meiner
Favoriten war KODAK Gold. Die Traxdata Gold waren dagegen
überhaupt nicht zu empfehlen, obwohl die alten Vorgänger
6x noch gut waren. Bei den blauen Rohlingen kann es bei
einigen Playern (Ich habe das z.B. bei einem SONY-Gerät
festgestellt.) Probleme geben, da diese das rote
Laserlicht nicht so optimal reflektieren.
Bei Überlängen-CDs habe ich weniger Probleme gehabt, von
alten Playern werden sie im allgemeinen besser akzeptiert.
Die Qualität der goldenen 80er von Memorex waren stark
abhängig vom Laufwerk und dem einzelnen Rohling, von
totalem Schrott bis hervorragend war alles dabei!
Das Problem: Hat man erst einmal eine gute Rohlingsorte
gefunden, ändert der Hersteller nach relativ kurzer Zeit
wieder die Mischung, leider fast immer zum schlechteren.
Die Rohlinge werden immer billiger, aber auch qualitativ
schlechter. Es ist schon schwer richtig gute Rohlinge zu
finden, da die meisten nur noch Wühltischware für unter 50
Cent kaufen, statt auf Qualität zu achten. Als früher
(1998) nur Rohlinge von Markenherstellern (Stück ca. 1...4
Euro) zu kaufen waren, war die Qualität insgesamt
wesentlich besser. Auch kaufen die Hersteller bei
Engpässen woanders Rohlinge auf... die Qualität kann schon
eine andere sein.
Es ist möglich, reine HiFi-CD-Rs zu kaufen, die zwischen 1
und 2 Euro kosten. Diese CD-Rs kosten aufgrund einer
GEMA-Kennung mehr, die auf diesen CDs sein muss, damit
HiFi-CD-Recorder diese annehmen. Die Hersteller führen
dazu eine Betrag an die Musikindustrie ab. Da diese
Rohlinge aber direkt für Audio-CD-Player gedacht sind, ist
ihr Reflexionsverhalten meist etwas besser, da hier nicht
so stark gespart wird, wie bei billigen Computer-CD-Rs.
CD-Recorder erzeugen aber auch nicht immer 100-%-ige
Kopien, weshalb man hier, sofern man wirklich unbedingt
einen haben will, doch schon einen etwas teuren nehmen
sollte und keine Billig-Angebote. Neue Rohlinge sind
optimiert für hohe Geschwindigkeiten (48x), so kann es mit
langsameren Brennen dann zu nicht so guten Ergebnissen
kommen. Das Problem gibt es bei Audio-CD-Rs nicht.
Jeder neue Brenner kann zwar CD-RWs brennen, da
diese jedoch einen wesentlich geringeren Reflexionsfaktor
(etwa 20 statt 70 %) besitzen, ist das Auslesen (auch auf
RW-Playern) schwerer, weshalb ich sie für Audio überhaupt
nicht empfehlen kann. Vorteil der neuen Player, die auch
CD-RWs unterstützen, ist aber meist eine bessere Abtastung
und Fehlerkorrektur, was wieder einen besseren Klang
besonders bei leicht zerkratzten Standard-CDs und vor
allem CD-Rs bewirkt.
11. Harddisk-Recording
Wie man eine CD-Kopie macht, ist klar, aber wie sieht es
bei analogen Quellen, wie Schallplatten, Kassetten, Tuner
etc. aus? Normalerweise ist die LP (z.B. alte Alben) die
Quelle. Um jegliche Verschlechterung auszuschließen,
sollte man dazu die Signalquelle direkt über ein
hochwertiges Kabel (oder Adapter) an die Soundkarte
anschließen. Bei Plattenspielern ist natürlich eine
hochwertige Phono-Vorstufe (hier
zum Selbstbau), passend zum System dazwischen zu
schalten. Üblich sind magnetische Systeme, die mit
bewegtem Magnet engl. Moving Magnet (MM) arbeiten.
Seltener sind Moving Coil-Systeme (MC), bei denen der
Magnet feststeht und die Spule bewegt wird. Die
Ausgangsspannung ist bei denen meist etwas (teilweise
Faktor Zehn) geringer, was wiederum schlechter für den
Rauschabstand ist. Zur Qualität von Schallplatten lässt
sich nichts allgemeines sagen, die Unterschiede beim
Knistern und Knacksen sind enorm.
Wichtig: Für die Soundkarte gilt Tipp 12!
Kassetten eignen sich durch das stärkere Rauschen meist
nicht. Bei guten, nicht zu alten Aufnahmen vor allem mit
einem DOLBY-Rauschminderungssystem, hat man jedoch auch
dafür eine ausreichende Grundlage.
Zur Not kann man mit Denoisern die Aufnahme noch etwas vom
Rauschen befreien, die verschlechtern aber oft den Klang!
Das Sampling sollte in der maximalen Qualität erfolgen,
die die Soundkarte bietet, wenn mehr als 48 kHz
Samplingrate möglich sind. Optimal sind dann 96kHz/24Bit,
bei "gewöhnlichen" Soundkarten sollte man aber trotzdem
44,1 statt 48 kHz nehmen. Grund dafür ist, dass das
Downsampling von 48 auf 44,1kHz (was für die CD nötig ist)
mehr klangliche Nachteile mit sich bringt als man durch
die nur unwesentlich höhere Samplingfrequenz (9 %)
gewinnen würde.
Die Aussteuerung sollte so hoch wie möglich erfolgen, das
ist besonders beim 16-Bit-Sampling wichtig. Vorher testen
und die Peaks bei etwa -2 dB aussteuern. Aber Vorsicht vor
Übersteuerungen, diese sind der Tod für die Aufnahme. Also
dann noch einmal versuchen. 16-Bit-Auflösung erlaubt eine
maximale Dynamik von etwas über 90 dB, da das
Quantisierungsrauschen (je nach Aussteuerung) hier bei
etwa 96 dB liegt. Besonders bei der Aufnahme trumpft die
24-Bit-Karte hier auf, da die Dynamik und das Rauschen bei
mehr als theoretischen 140 dB liegt, so sind auch
eventuelle Nachbearbeitung weniger "klangentziehend".
Normalerweise ist nur eine manuelle Nachbearbeitung
(Schneiden der Tracks, Ausbügeln der großen Knackser bei
Platten, ggf. Ein und Ausblenden) nötig. Beim
Normalisieren muss man aufpassen, da schnell
Übersteuerungen und somit Verzerrungen möglich sind,
obwohl sich alle Samples immer im definierten Bereich
befinden.
Zum Schluss vor dem Brennen auf CDs nicht vergessen, wenn
nötig die Daten auf das Format 44,1 kHz / 16 Bit / PCM /
Stereo runterzurechnen.
12. Soundkarte
Hier scheidet von vornherein Billig-Schrott aus, da dort bereits an den Wandlern gespart wurde. 16 Bit / 48 kHz allein sagt nur etwas über die maximal erreichbare Qualität aus. Hierbei sind theoretisch etwa 96 dB SNR erreichbar, das müssen aber auch die analogen Stufen unterstützen. Messungen ergaben besonders bei billigen, älteren Karten oft Werte unter 70dB! Das schafft sogar mein altes, analoges Kassettendeck mehr! Die mit Abstand schlechtesten Werte haben On-Board-Sound-Eingänge. (Von PC-Zeitschriften und auch mir selbst gemessen!) Gute Karten erreichen über 85 dB. Bei den neuen Karten ist der DA-C schon wesentlich besser als bei älteren Karten, also sind die Unterschiede bei der Wiedergabe gering. Die AD-Converter, die man für das Harddisk-Recording braucht, sind aber nach wie vor dort klanglich oft sehr problematisch. Hier ist eine hochwertige Soundkarte Pflicht. Man kann auch einige aktuellen On-Board-Soundkarten nutzen, wenn man sie ausschließlich, über digitale Ein- und Ausgänge anschließt
Im Consumer-Computer-Bereich wird im Moment viel auf billige Produktion ausgelegt, wie bei den tönenden Joghurtbechern, die man als Boxen verkauft, zu sehen und zu hören! Man verkauft auch Dolby Digital Soundkarten und Mini-Boxensysteme für den Computer, die aber nur eins sind: Schrott! Deshalb: die digitalen AC3-Ausgänge einer Soundkarte benutzen und diese einem richtigen "Decoder mit Verstärker" zuführen.
Eine gute Alternative können heute USB-Audiointerfaces
(z.B. Focusride oder MOTU) sein, die mindestens zwei
hochwertige, symmetrische Eingänge mit 192 kHz / 24-Bit
Sampling bieten.
Zuerst mal etwas generelles: Es existiert bis heute kaum ein verbreiteter Kopierschutz, der nicht geknackt werden konnte.
Ich kaufe, seit dem Kopierschutzverfahren für Audio-CDs
kamen, keine CDs mehr, die einen Kopierschutz enthalten,
da ich die CDs auf dem PC nicht abspielen kann, es sei
denn im Nahe-Telefon-Qualität-Format. Und mir damals von
den gekauften (geschützten) CDs jedes mal Kopien zu
erstellen, die dann auch auf allen CD-Playern laufen, war
mir zu doof, heute ist das sogar verboten! Für gute
Qualität bin ich bereit zu zahlen, aber für schlechte CDs,
die dann noch geschützt werden, NEVER!
Da im Sommer 2003 das Urheberrecht geändert wurde, ist
es nun nicht mehr gestattet, ein Kopierschutzverfahren
direkt zu knacken oder einen (an sich wirksamen
;)) Kopierschutz auszuhebeln. Die Privatkopie ist
(wie zuvor) prinzipiell nicht verboten.
Da einige CD-Laufwerke aber gegen das Rippen von
solchen, geschützten CDs immun sind, ist dann das
Einlesen und Umwandeln der CD (rein theoretisch) wieder
legal. Paradox, dass es nicht interessiert, ob man
kopiergeschützte CDs kopiert, sondern wie man das macht.
Das ist aber sichtlich eine rechtliche Grauzone.
Das heißt auch, wer seine Audio-CD in den Audio-CD-Player
steckt und dann digital mit der Soundkarte aufnimmt, macht
eine legale, digitale Kopie, da man den Kopierschutz nicht
aushebelt. (er ist so ja von Natur aus nicht wirksam...)
Da nicht nur das Umgehen selbst, sondern auch die
Veröffentlichungen zum Knacken verboten sind, darf niemand
mehr beschreiben, wie diverse Kopierschutz-Verfahren
umgangen werden können. Die Musikindustrie mahnt auch
jeden sofort ab, der das knacken nur annähernd irgendwie
beschreibt...
| Rechtslage in Deutschland (Stand 05-2003):
Das Kopieren von Daten-CDs, Audio-CDs, VHS-Videos
und DVDs ist nur unter bestimmten Voraussetzungen
gestattet. Dazu zählt das Erstellen von
Sicherheitskopien, obwohl einige Gerichte dies
auch anders sehen... Aber auch das Brennen von
Audio-CDs, die man z.B. im Auto hören will, ist
gestattet, solange man Original und Kopie nicht
gleichzeitig verwendet und Kopien (oder auch
Originale) nicht weiter gibt. Kopien sind nur für
den Privatgebrauch (Sicherheitskopie) und auch
hier keine (auch unentgeltliche) Weitergabe. Wer einen Kopierschutz knackt oder gezielt umgeht, verletzt das Urheberrecht. Seit 2002 muss nach geänderter Rechtslage der CD-Hersteller auf dem Cover auf einen evtl. vorhandenen Kopierschutz hinweisen. Stand 2021 hat sich daran nichts verändert. |
Damit alle Audio-Player geschützte CDs abspielen, sind
die Tracks konventionell darauf vorhanden, nur das
Inhaltsverzeichnis der CD, das TOC (Table of contents)
enthält falsche Einträge, die CD-ROM-Laufwerke sogar
blockieren lassen können. Leider sind neuere Verfahren
noch schlimmer, sie bringen definiert Fehler in den
Datenstrom ein, die bei gealterten CDs mit Kratzern dann
deutlich früher hörbar werden. Ein Audio-CD-Player
repariert diese Fehler, die meisten CD-ROMs oder
DVD-Laufwerke lesen aber einen falschen Wert, so dass es
zum Knacksen oder sogar springen bei der Wiedergabe kommt.
Diese Un-CDs entsprechen nicht dem CD-Standard, weshalb
auch kein compact-disk-Logo mehr auf der Hülle aufgebracht
sein darf.
Bei anderen Verfahren wird sogar versucht, gezielt gegen
Raubkopierer vorzugehen, da diese bei Kopierversuchen
Einstellungen im Windows-System verändern. Das dürfte
sicher die Anwälte freuen, da diese Verfahren gegen
geltendes Recht (Programmieren von Viren?) verstoßen. XCP
von SONY? -> so-nie ;)
Und diese DRM-WMA-Files oder das apple-Pendant, die man legal im Internet downloaden kann, will auch kaum einer haben, da man diese Dateien in nur sehr wenigen Playern, kaum einen (richtigen) Autoradio und keinen Linux-PCs etc. direkt wiedergeben kann. Man darf (bzw. kann) sie nicht knacken, jedoch kann man den Rechte-Schutz legal umgehen. Hat man das Recht, mind. eine Audio-CD(-RW) zu brennen, kann man das tun und diese legal-freie Version rippen und legal in ein MP3 umwandeln, um es z.B. im Auto abzuspielen. Und wieder: Es ist nicht entscheidend, dass man die kopiergeschützte Datei umwandelt und dann kopiert, sondern wie man es macht...
Analoge Videokopierschutzverfahren, wie MacroVision
(Version 1...4), die auf DVDs (und früher Videokassetten)
eingesetzt werden, erzeugen nicht sichtbare Impulse, die
die Videoeingangsstufe des analogen, aufnehmenden
Videorgerätes stören. Die Lizenzinhaber bestehen darauf,
dass solche VHS- oder DVD-Recorder nicht immun dagegen
werden. Da dieses Verfahren im analogen Videosignal
enthalten ist, lässt es sich nicht direkt digital
speichern, eine Information auf der DVD sorgt dafür, dass
der DVD-Player selbst dieses Signal erzeugt.
Aber auf DVDs existieren ja noch weitere Schutzverfahren
wie CSS (Content Scrambling System) und RPC
(Regionalcode). Einige Infos hierzu sind auf meiner Videoseite.
14. Lagerung Datenträger, Bänder und Bandlaufwerke (auch Videorecorder) :
Obwohl heute kaum noch Bänder benutzt werden, gibt es sie
noch immer, sei es in alten Videorecordern,
Kassettendecks, Spulen-Tonbandgeräten oder DAT-Recordern.
Zum Schutz der Bänder sollten diese von Magnetfeldern
(Lautsprechern, Fernsehern, Motoren etc.) ferngehalten
werden. Auch große Temperaturänderungen oder hohe
Luftfeuchtigkeiten sind alles andere als optimal. So
sollten sie bei niedriger Raumtemperatur (ca. 15° C)
gelagert werden. Bei höheren Temperaturen verstärkt sich
der Kopiereffekt, eine magnetische Lage ist dann (bei
Analogmaterial) leise auf der anderen daneben (an der
Stelle, die früher b.z.w. später kommt) mit vorhanden.
Irgendwann gibt es Echos... Auch durch den Erdmagnetismus
werden Bänder mit der Zeit schlechter, weshalb
Studio-Originale in schweren Safes abgeschirmt liegen...
(Das mit der Temperatur gilt eigentlich ebenso auch für
CDs, DVDs, BluRays)
Da Bänder beim Kauf durch die Herstellung oft etwas
zusammenkleben, sollte das neu gekaufte Band erst komplett
einmal vor- und wieder zurück gespult werden, bevor man es
das erste Mal benutzt. Auch Bänder die (vor allem durch
billige Laufwerke) ständig hin- und hergespult wurden,
können so wieder in eine gleichmäßige Lage gebracht
werden. Gleiches gilt für Tapes, die lange irgendwo
lagerten. Dann läuft das Band im Recorder wieder leichter
und gleichmäßiger.
15. Erstellen von MP3-Dateien
Notwendige Programme: (Freeware für Windows)
| Lame |
Audiograbber |
WinAmp |
MP3tag |
MP3Gain |
| MP3-Codec | CD-Ripper | Player und ID-Tag-Editor | ID-Tag-Editor auch mit Cover etc. |
Zusatzprogramm zur
Lautstärkeanpassung verhindert Übersteuerungen von erzeugten MP3s |
Hinweis: Win32-kompiliertes LAME am besten von anderer
Quelle downloaden, Dann im LAME-Install-Verzeichnis die
INF-Datei auswählen und mit Rechtsklick im Menü
"installieren".
Damit LAME im Audiograbber ausführbar ist, die
lame_enc.dll aus dem LAME-Ordner in das
Audiograbber-Verzeichnis kopieren.
Bei Winamp ist eine empfehlenswerte Version die 5.2.x...
15.1 Zuerst erfolgt das Rippen (weitere Hinweise
siehe Tipp 10)
Um die Titelnamen und Interpreten zu erhalten, kann man
zuvor die CD-Text-Info einlesen, die aber nur auf wenigen
Kauf-CDs enthalten sind. Oder mit FreeDB aus dem Internet
die Daten erkennen lassen. (geht natürlich nur bei
unveränderten Alben, Maxis oder Samplern) Infos zum Jahr
und Genre werde ebenfalls in den ID3-Tag geschrieben. Man
kann neben dem Jahr, Albumnamen auch manuell bei jedem
Track Titel (und Interpret bei Compilation/Sampler)
angeben.
Die Daten werden im PCM-Format (unkomprimiert) 44100 Hz /
Stereo / 16 Bit in WAV-Dateien auf der Platte gespeichert.
Zuerst werden alle Dateien gerippt, danach zu MP3s
komprimiert.
Einstellung: MP3-Datei über temporäres WAV
Zuerst alles in den Arbeitsspeicher zu kopieren, dann auf
Platte. Richtwert mind 10,5 MB pro Minute muss frei sein.
Normalisieren und Fading abschalten!
15.2 Danach kommt das Komprimieren
Neben verschiedenen Codecs (verschiedene
Software-Hersteller) gibt es auch zahlreiche Unterschiede
bei der möglichen Speicherung. Heute gilt LAME als der
beste freie MP3-Codec, ich denke der beste überhaupt.
MP3-Dateien sind frei, (fast) überall abspielbar (auch auf
IPods, Handys etc.), uneingeschränkt veränderbar und
können auch direkt in jedes andere Format gespeichert
werden.
Es gibt auch andere Formate:
- WMA ist zwar qualitativ vergleichbar mit MP3, wird aber von deutlich weniger Geräten unterstützt, da er direkt von Microsoft stammt. WMA kommt bei gleicher Qualität mit etwa 1/3 weniger Datenrate gegenüber MP3 aus, was entspräche WMA mit 128 kbps = MP3 mit 192 kbps... Das nachträgliche Ändern, anpassen, Editieren von WMA ist aufwändiger. Das Format existiert nur, weil Microsoft den Codec kostenlos dazu gibt und es Onlinediensten DRM (Digital Rights Management) ermöglicht, diese WMA-DRM-Files werden aber nur auf wenigen Playern wiedergegeben.
- MP3plus oder auch MP4 sind Weiterentwicklungen von
MP3, auch sie haben bei niedriger Datenrate eine höhere
Qualität. Sie haben sich nur auf PC-Ebene und bei
einigen teuren Playern (Multimedia) durchgesetzt.
Gegenüber MP3 kann bei gleicher Qualität oft die
Datenrate nahezu halbiert werden. Auch hier spielen nur
wenige Player diese Dateien ab.
- ogg vorbis ist ein open-source-Codec und qualitativ weiter entwickelt als MP3 und co. nur wenige Player können dieses Format wiedergeben.
- AAC Advanced Audio Codec wird z.B auf ipods benutzt und ist deshalb nicht immer kompatibel zu anderen Playern und Autoradios.
- FLAC (Free Lossless Audio Codec) verlustfreie
Kompression: je nach Quelle ist hier nur
Kompressionsfaktor 1,4 bis 3 erreichbar. Mit Messignalen
und Tönen auch mehr, bei Musik besitzt die FLAC-Datei
oft nur 60% der PCM-WAV-Größe.
Einstellungen beim Komprimieren: (MP3-Lame)
Die Qualität wird immer auf HOCH (am langsamsten)
genommen, bei weniger sind sonst Qualitätsunterschiede
auch bei hohen Datenrate eher hörbar. Dazu wird Stereo
oder Joint-Stereo eingestellt, Dual-Stereo benötigt
deutlich mehr Datenrate für gleichen Klang, Joint-Stereo
ist bei niedrigen Datenraten (<= 192 kbps) klanglich
besser, es gehen aber einige Richtungsinformationen
verloren.
Standard ist CBR (Konstante Bitrate) 128 kbit/sec gilt als
Standard, sollte aber als absolutes Minimum angesehen
werden. Das entspricht Kompressionsfaktor 11 gegenüber dem
CD-Original. Ich empfehle mind. 160 kb/s (Faktor 8,8), mit
192 kbps (Faktor 7,35) ist man immer auf der sicheren
Seite. Gekaufte MP3-CDs haben meist 192 kbps. Maximum sind
320 kbps möglich (Faktor 4,4) das ist eigentlich kaum vom
CD-Original zu unterscheiden, aber für das Auto etwas zu
viel, da man durch Fahrgeräusche weniger Qualitätsfehler
mitbekommt. Leider hängt das Endergebnis immer vom
Quellmaterial ab, bei neuen digitalen CD-Aufnahmen
erreicht man auch bei niedrigen Datenraten gute Qualität,
bei älteren analogen Aufnahmen (z.B. von LPs etc.)
benötigt man generell mehr, hier sind selbst z.B. durch
Rauschen bei 192 kbps Unterschiede hörbar.
Es gibt auch die Möglichkeit die Bitrate abhängig von der
Musik ändern zu lassen (Variable Bitrate oder Alternate
Bitrate) Einige Hardware-Player können das manchmal nicht
richtig wiedergeben, es gibt Knackser oder es dauert beim
Start sehr lange, alles einzulesen. Bei sich
ändernden Signalen lohnt sich das besonders, bei
Standard-Pop sind die Speicherplatz-Gewinne eher klein.
Weiterhin ist die Berechnung der Größe der Enddatei beim
Komprimieren nicht genau möglich. Umgekehrt kann man auch
schwerer an bestimmte Zeitmarken beim Abspielen springen.
Äquivalent werden VBR4 .. VBR1 als Qualität eingestellt.
ABR sollte man vermeiden, da noch mehr Player Probleme
damit haben.
15.3. ID3-Tag bearbeiten
Damit man das MP3 später richtig zuordnen kann, sollte
nicht nur der Dateiname (Bestehend aus Interpret, Titel,
bei Alben zu Beginn evtl. die Tracknummer), sondern auch
der ID3-Tag stimmen. Dieser Informationsblock enthält
Infos z.B. zum Interpreten, Titel, Erscheinungsjahr,
Albumname und wird z.B. im Autoradio angezeigt. Pflicht
ist immer ID3-Tag Version 1, bei längeren Bezeichnungen
kann man zusätzlich auch die 2. Version speichern.
Autoradios und andere Hardware-Player lesen evtl. nur
Version 1 aus.
Mit WinAmp kann man sich die Dateien anhören und diese
Informationen direkt bearbeiten. Dazu in der
winamp-Playlist Rechtsklick auf "File Info" bzw. "View
file info". Nach der Eingabe werden mit Klick auf Update,
diese Daten in die MP3-Datei geschrieben.
Komfortabler geht es mit MP3tag, hier kann auch ein
kleines Bild .B. des Album-Covers mit eingefügt werden.
Die MP3-Files können dann in einzelne Verzeichnisse
sortiert werden.
Winamp-Playlisten (M3U, PLS) werden evtl. auch von anderen
MP3-Playern gelesen.
15.4 Normalisieren
Das Normalisieren der unkomprimierten Dateien sollte man
vermeiden, da hier noch keine Informationen zu dem
RMS-Werten (Effektivwerte und wirkliche Lautstärke)
vorliegen. Damit alle Dateien etwa gleich laut sind,
sollten sie später normalisiert werden. Das geschieht für
gemischte Verzeichnisse und Alben getrennt. Bei Alben
dürfen die einzelnen Songs nicht unterschiedlich angepasst
werden. Dazu mit MP3Gain ein Verzeichnis (Add Folder)
importieren. Bei einem Album "Album Analysis", sonst
"Track Analysis". Hier werden nun die Pegel (Volume)
eingelesen, unter clipping darf kein Y stehen, das würde
Verzerrungen bedeuten. Anhand des Target-Volume (z.B. 88
dB) wird die Verstärkung oder Abschwächung berechnet und
angezeigt, ob damit dann (Clip(track)) Verzerrungen
möglich sind.
Man kann das Target auch weiter verringern und Klirren zu
vermeiden. Mit Gain (Album Gain oder Track Gain) werden
die Pegel dann angepasst. Dann auf "Clear All", so werden
die Dateien aus der Ansicht entfernt. Das macht man mit
allen Verzeichnissen, die auf eine CD sollen. MP3Gain
arbeitet verlustfrei, da es die Lautstärkeinformationen
unabhängig von der Musik in jeden MP3-Frame schreibt.
15.5 Brennen (wenn nicht auf SDcard oder USB-Stick
kopiert)
Die Verzeichnisse mit den Dateien werden z.B. mit Nero auf
eine CD gebrannt. Diese sollte keine Multisession-CD sein
und abgeschlossen (finalized) sein. So passt mehr drauf
und die CDs können schneller beim Start eingelesen werden.
Auch gibt es so keine Kompatibilitätsprobleme. Langsam
brennen verbessert das Brennergebnis, so dass die CD dann
seltener (oder gar nicht) beim Hören auf schlechter Straße
aussetzt.
Aufpassen muss man evtl. bei Geräten, die kein Joliet
(Windows) auslesen, sondern nur ISO, hier werden die
Datei- und Ordner-Namen auf 8.3-Format gekürzt. Mit
DIR /X kann man sich diese Namen in der
Eingabeaufforderung anzeigen lassen. Je nach Autoradio
(z.B. JVC) werden Schnellanwahl-Tasten für die
Verzeichnisse unterstützt, wobei die Ordner mit 01...
beginnen müssen.
Auf eine CD-ROM passen üblicherweise etwa 702 MB, das sind
bei 160 kbps mehr als 610 Minuten Musik, also bei 4
Minuten pro Titel 152 Songs. Bei 192 kb/s sind es noch
über 510 Minuten, also mind. 127 Songs a 4 min.
Zum Testen nimmt man geeignete CDs, hier einige Tipps:
Ich kann nur wenige so genannte Test-CDs empfehlen, eine für Interessenten ist: "Hifi Check" der Zeitschriften "HiFi Test TV Video" und "Car-HiFi" für ca. 20,-Euro, auf der auch 3 (Bassmo Bill, R. Pidgeon, A. Di Moela) der unten aufgeführten Titel sind. Es wird ebenfalls erklärt, wie diese Stücke klingen sollen.
Für den Bassbereich (Tiefe / Präzision):
- Testfile
sweep.mp3 (50KB) : Dieses 10 Sekunden
lange File enthält zu Beginn eine Folge von
40Hz-Sinustönen, dann ab 2,0 s bis 10 s kommt ein
linearer Sweep (laufender Sinuston) von 20 bis 100Hz.
Hiermit kann man testen, ob die unterschiedlichen
Frequenzen im Bassbereich etwa gleich laut sind.
(VORSICHT mit der Lautstärke, man kann die Lautsprecher
zerstören!) (22 kHz, mono, 40 kBit/s)
- Bassmo Bill - Eth-mo-thing : Tiefstbass pur!
Vorsicht bei der Lautstärke, dient zum Testen der
Dynamik und Pegelfestigkeit der Boxen und der Endstufe.
Die präziseren Bass-Schläge zu Beginn (ca. 70Hz) dürfen
nicht grollen und die ganz tiefen Töne (ca. 45 Hz)
müssen absolut voluminös und druckvoll wiedergegeben
werden. (VORSICHT mit der Lautstärke, man kann die
Lautsprecher zerstören!)
- Goldie - Inner City Life : In diesem relativ bekannten Jungle-Teil müssen die Bass-Samples klar unterscheidbar sein, sie dürfen nicht dröhnen oder gar grollen. Die Bässe dürfen den Klang im Frequenzbereich darüber nicht beeinflussen.
- J.M.J. & Richie - Free La Funk (Remix) : Die Bass-Samples müssen sich unterscheiden und sollten etwa die gleiche Lautstärke besitzen. Die Grundfrequenzen der einzelnen Basstöne liegen "nur" zwischen 40...80Hz, sind also noch eine Oktave vom Tie(hhhhhh)fstbass entfernt.
- Dune - Million Miles from Home : Trotz der relativ tiefen Bässe (<50 Hz) muss der Bassschlag als solcher erkennbar sein, auch wenn er relativ weich, füllig und voluminös klingt.
- Rebecca Pidgeon - Grandmother : Die Stimme muss exakt aus der Mitte kommen und darf nie nervend oder aggressiv wirken, sie ist verspielt und neutral, das ist in den laut gesungenen Passagen wichtig. Hiermit können so auch Mittenverfärbungen der Lautsprecher erkannt werden.
- Al Di Meola - The Prophet : Bei diesen hohen
Tonpassagen darf es nie schrill, hart und aggressiv
werden, die Höhen müssen explosiv, verspielt und
dynamisch rüberkommen. Metallkalotten dürfte man hier
heraushören. Die Töne überstreichen den Mitten-,
Präsenz-, Brillanz- und Hochtonbereich (alles über 500
Hz).
High Frequency Sampling:
Das Ohr ist in manchen Bereichen empfindlicher, als uns "Experten" mit Messgeräten manchmal glaubhaft machen wollen. Bei einer 96 kHz Samplingrate sind über 40 kHz Bandbreite erreichbar. Nun kommt die Ausrede anderer, der Mensch hört nur bis 20 kHz.Dies ist nur zum Teil richtig. Zwar nimmt der Mensch (abh. von der Lautstärke, vom Alter etc.) Sinus-Töne bis etwa 16 kHz wahr. (20 kHz-Töne hört nur ein Baby) Aber der Mensch erfasst indirekt Oberwellen eines Klangs, die auch im Frequenzbereich darüber liegen können. Das diese Oberwellen entscheidend sind, zeigt sich daran, dass eine hohe Sinusfrequenz anders klingt, als eine Dreieck-, Sägezahn- oder Rechteckschwingung. Der Unterschied liegt in der Verteilung und dem Pegel der Oberwellen... Deshalb sagen auch High-Ender, dass Vinyl-Platten manchmal besser als CDs klingen. Und deshalb klingen auch Geräte mit erweiterten Frequenzbereich wie Audio-DVD (DVD-A), Superdisk (SA-CD), Wide-Range-DATs (96 kHz DAT-Recorder von Pioneer) oder auch das Legato-Link-System (von Pioneer entwickeltes Prinzip, bei dem man zusätzlich Frequenzen über 20 kHz hinzurechnet) meist besser (weicher, harmonischer) als Geräte mit "beschnittenem Frequenzgang". Das lässt sich auch mittels Fourier-Reihenanalyse erklären, wenn man Signale als Summe von Sinusschwingungen darstellt. Denn je steiler ein Anstieg im Zeitbereich ist (z.B. Flanke eines Rechtecksignals), desto größer muss die Bandbreite sein, um dieses Signal zu übertragen. DAS HEISST, DAS NICHT (NUR) DIE FREQUENZ DIREKT, SONDERN DER ANSTIEG DER FLANKE EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE (FÜR NOTWENDIGE BANDBREITE) SPIELT. Bei einem Impuls oder einem idealem Rechteck mit unendlich steilem Anstieg müsste auch die Bandbreite des (elektrischen) Übertragungskanals unendlich sein, um am Ausgang den selben Impuls b.z.w. das gleiche Rechteck zu erhalten, auch wenn die eigentliche Rechteckfrequenz wesentlich niedriger ist.
Die Verteilung und der Pegel dieser Harmonischen (Vielfache der eigentlichen Originalschwingung) ist abhängig vom Signal, je "eckiger" es ist und steiler die Flanken sind, desto größer ist der Pegel der Harmonischen. Ein reines Sinussignal besitzt als einziges keine Harmonischen, mit diesen Signalen wird aber immer getestet!
Ein 1 kHz Dreieck oder auch ein Rechteck hat z.B. Oberwellen (ungerade Harmonische) bei 3, 5, 7, 9, 11 kHz u.s.w., wobei der Pegel jedoch kontinuierlich abfällt. Ein 1 kHz-Sägezahn-Signal würde bei 2, 3, 4,...kHz Oberwellen (gerade und ungerade Harmonische) besitzen. Bei komplexen Klängen wäre ein weit gefächertes Spektrum der Fall, das auch bis über 20...30 kHz hinausgeht.
Mit einer 44,1kHz-Samplingrate lassen sich zwar Töne bis 20 kHz übertragen, jedoch sind das immer nur Sinustöne, da sie keine Oberwellen besitzen. So braucht man nicht nicht zu wundern, dass CD-Player immer so steril klingen, da alle Frequenzen oberhalb von 10 kHz nur sinusförmig sind. Eine 20 kHz-Schwingung wird nur 2x abgetastet, daraus soll dann wieder die Original-Schwingung hergestellt werden...
Zusammengefasst: Direkte Töne über 20 kHz kann der Mensch nicht wahrnehmen, allerdings muss man sie mit übertragen, will man, dass das aufgezeichnete, nichtsinusförmige Signal (Musik) möglichst genauso klingt, wie das Original.
Je größer der Frequenzbereich von Geräten, desto besser
wird im allgemeinen auch ihr Impulsverhalten. Das lässt
sich mathematisch auch mittels der Fourier-Transformation
beweisen.
Warum nicht unendlich breit? -> Abgesehen, davon dass
das nicht geht, ist es nicht sinnvoll, denn die Oberwellen
nehmen immer mit höherer Ordnung im Pegel ab, so dass sich
die Übertragung (Musik und Sprache, bei Frequenzen über
10k Hz) Harmonischer ab 4. oder 5. Ordnung kaum noch
lohnt. Das heißt bei einer 15 kHz-Schwingung könnte man
über 45...60 kHz aufhören, was diese Samplingraten dann
erklärt. Denn eine 16 kHz-Schwingung lässt sich bei 192
kHz bis zur 5. Oberwelle übertragen, was also, was diese
Theorie angeht, ausreicht. Im allgemeinen genügen bei den
meisten Signalen maximal 10 Oberwellen, damit die
Unterschiede so minimal werden, dass man sie sicher nicht
mehr unterscheiden kann.
Ob es hörbar ist, noch weitere zu übertragen, wer weiß,
vermutlich nicht. Während die Unterschiede zwischen 96 und
44,1 kHz noch für viele auf entsprechender Anlage hörbar
sein dürften, wird es bei 192kHz im Gegensatz zu 96kHz
wohl nur sehr kleine Unterschiede geben. Brauchbare und
real-nachvollziehbare Untersuchungen dazu gibt es meines
Wissens noch nicht.
Und die Möglichkeit, weitere Oberwellen hinzuzurechnen
(was man bei hochwertigen Player mit den derzeitigen 44,1
kHz / 16 Bit Aufnahmen ja auch macht) besteht ja immer
noch, um das letzte Quäntchen herauszuholen.
Dazu müssen aber auch die Aufnahmen schon in diesem Format
gemacht werden, bei Originalen von Standard-DAT (48 kHz,
16 bit) wird natürlich die Kopie genauso klingen. Das
Hauptproblem hierbei ist aber die Aufnahme, während es bei
Mikrofonen und entsprechenden 24-Bit-DACs eher keine
Probleme gibt, ist das bei den synthetischen Pop- und
Dance-Klängen etc. etwas anders. Da diese Samples nicht
das notwendige Format haben, ist entsprechender Aufwand
nötig.
Noch zum Thema Frequenzbereich: Zwar gibt die jeweilige
Grenzfrequenz an, ab wann der Pegel unter -3dB fällt, sagt
aber nichts darüber aus, wie stark der Abfall danach ist.
Analoge Aufzeichnungs- und Übertragungsmedien haben einen
flacheren Abfall als es bei digitalen Medien der Fall ist,
wo mit sehr steilflankigen Filtern gearbeitet werden muss,
um keine Probleme (Shannon-Abtast-Theorem) zu bekommen.
Während bei einer CD (44,1k Hz Sampling) definitiv kein 22
kHz-Sinuston aufgezeichnet werden kann, ist das bei einem
Analogtape (Kassettendeck) möglich, auch wenn dort die
obere Grenzfrequenz ebenfalls bei 20 kHz liegt, der Ton
ist nur leiser (je nachdem, vielleicht ca. -10 dB) als bei
der Referenzmarke. Besonders bei Schallplatten ist oben
herum noch Spielraum vorhanden, so dass bei einigen
Abtastsystemen die obere Grenzfrequenz bei bis zu 25...30
kHz liegen kann, darüber aber immer noch leisere Anteile
vorhanden sind.
Diese harmonischen Oberwellen sorgen dafür, dass das
Signal nicht so "analytisch" hart klingt, wie es besonders
bei ersten CD-Playern der Fall war. Das heißt Harmonische
Oberwellen sorgen wirklich dafür, dass Klänge harmonischer
klingen.
Auch gibt es am Punkt der -3-dB-Grenzfrequenz bereits eine
starke Phasenverschiebung von 45°, die sich auf die
Räumlichkeit auswirken kann.
Andererseits: Die untere Grenzfrequenz des menschlichen
Ohres liegt bei etwa 15...20 Hz. Die Tiefbässe kann das
Ohr allein kaum noch wahrnehmen, quasi alles wird über den
Körper (Knochen etc.) übertragen. Das einzige
Musikinstrument (neben Synthesizern), was solchen tiefen
Töne erzeugt, ist die Orgel in der Kirche, so reichen für
"gewöhnliche" Musik 25 Hz (-3 dB!) voll zu. Dafür braucht
man schon gewaltige Lautsprecher, so dass für den
Hausgebrauch schon etwa 30 Hz vollkommen ausreichen,
obwohl hier eine volle Oktave fehlt. In Standard-Pop-,
Dance-, selbst bei Jungle und Drum 'n Bass sind bei
Tiefstbässen die Grundfrequenzen darüber, sie liegen im
allgemeinen über 40 Hz. Da ist eher die Abschwächung bei
der unteren Grenzfrequenz entscheidend, die bei
Lautsprechern oft bei -8 dB und nicht -3 dB angegeben
wird.
Die Phasenverschiebung, die durch die bei der unteren
Grenzfrequenz entsteht, ist nicht relevant, im Gegensatz
zum oberen Frequenzbereich, da selbst starke Abweichungen
bei der Phase bei solchen tiefen Frequenzen mit
Wellenlängen von mehr als 10 m kaum noch eine Rolle
spielen. Das heißt, dass man auch unten sparen kann, aber
nicht muss, gute CD-Player haben eine untere Grenzfrequenz
von unter 2 Hz. Das hört wirklich kein Mensch mehr, kann
aber nicht schaden, zumal sich die untere Grenzfrequenz
bei mehreren nacheinander geschalteten Geräten stark
verschlechtert.
Zu den Klirrfaktoren: Der Klirrfaktor k ist das
Verhältnis zwischen dem Pegel der Sinusschwingung und
denen der durch die Geräte entstehenden Oberwellen. Meist
nimmt man jedoch nur die Frequenzen bis zur zweiten oder
dritten Oberwelle, da die Frequenzen darüber gewöhnlich
nur noch schwach vertreten sind und man so die Werte
besser miteinander vergleichen kann. Bei einzelnen
Sinus-Tönen werden sehr hohe Klirrfaktoren (teilweise bis
zu 10%) vom Ohr (Verdeckungseffekte) akzeptiert, ohne dass
es störend wirken würde. Das sich das bei komplexen
Klängen verändert, hört dann jeder. Während im Bassbereich
ein Klirrfaktor von über einem Prozent nur schwer oder gar
nicht ausgemacht werden kann, sind manchmal selbst weniger
als 0,5% bei bestimmten Klängen mit hohem
Frequenzanteil als Unterschied wahrnehmbar. Dafür ist aber
ein geschultes Ohr (und eine gute Anlage natürlich auch)
unbedingt Voraussetzung. Das ein geschultes Ohr wirklich
besser ist, zeigen z.B. Musiker, die sehr genau (<1 %)
Tonhöhenänderungen wahrnehmen können.
Jedoch sagt der Klirrfaktor allein nur wenig über den
Klang z.B. eines Verstärkers aus, da z.B.
Anstiegsgeschwindigkeiten bei (musikalischen) Klängen
ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, Musik ist nun mal
kein Test-Sinuston. Das zeigt sich auch in der Praxis:
Würde man eine Verstärkerstufe z.B. stark rückkoppeln,
ließe sich der Klirrfakter auf Werte weit unter 0,001 %
reduzieren, jedoch klingt sie dann schlechter, da sich
andere Parameter (Impulstreue etc.) verschlechtern.
So ist es eben immer: Nur mit Messwerten, wie unterer
und oberer Grenzfrequenz, Klirrfaktor, Rauschabstand und
Dämpfungsfaktor lässt sich keine Aussage über den Klang
(Musik) treffen.
Diese Eckdaten lassen nur wenig Aussagen zu: Ein Gerät,
was hier überall schlecht dasteht, wird so auch nicht gut
klingen.
Auch ist es ein Unterschied, ob man Klirrfaktoren von
Verstärker, Tapes etc. vergleicht. Prinzipbedingt
unterscheiden sich hier wiederum die Lage und Amplitude
der Oberwellen, es werden aber nur die ersten 2
Harmonischen gemessen. So kann es sein, dass man bei einem
Verstärker mit k<0,2 % das Klirren wahrnimmt, nicht
jedoch bei einem Analog-Kassettendeck mit k=0,5 %.
Alles ist abhängig von der Messmethode! Das gilt auch für
Dämpfungsfaktoren von
Verstärkerendstufen. Das beste Mittel für große
Dämpfungsfaktoren sind dicke Kupferleitungen vom "Endtopf"
zum Speaker, sowie viele parallele MOSFET mit sehr kleinen
Innenwiderständen (RDSon).
Selbst heute ist das Ohr und seine genaue Funktionsweise
besonders im Zusammenhang mit dem Gehirn noch nicht zu 100
% ergründet. Das Ohr ist als alles andere als simpel oder
einfach logarithmisch. In einigen Bereichen ist das Ohr
einfach zu überlisten, woanders wieder überhaupt nicht!
Das ist auch der Grund, weshalb gute
Audio-Komprimierverfahren sehr aufwendig sind und eine
hohe Rechenleistung erfordern. Genau bei diesen
Konfigurationen (komplexe Klänge mit breitbandigen
Signalen mit viel Hochtonanteil verraten sich die
Komprimierverfahren, wie z.B. MP3 dann, da sie ständig neu
bewerten und über Filterbänke arbeiten.
Weshalb man sich nicht wundern muss, dass bei dumpfen
Aufnahmen die komprimierte Fassung quasi genauso
(schlecht) klingt, wie das Original.
Surround:
Bei High-Endern war Surround lange Zeit verpönt, es gab
einen Wettkampf zwischen Stereo und Raumklang: warum nutzt
man nicht die nächste Generation für das beste beider
Tonsysteme. AC-3 ist zwar für Filme hervorragend geeignet,
bei hochauflösender Musik mussten klangliche Abstriche
gemacht werden.
Heutzutage, wo die CD mit einer Samplingfrequenz von 44,1
kHz, 16 bit Stereo PCM etwas "betagt" (anno 1982) ist und
mehr Datenkapazität z.B. auf DVDs zur Verfügung steht,
sollten mehr Daten für den guten Klang benutzt werden, als
das CD-Format noch zu komprimieren.
Auf eine Standard-CD passen mit der einfachen
Audio-CD-Fehlerkorrektur etwas mehr als 740 MB. Dies lässt
sich noch durch Zusammenrücken der Spuren auf etwa 800 MB
vergrößern. Auf eine einschichtige DVD passt schon mehr
als die 5-fache Menge, ca. 4,7 GB. Diese lässt sich durch
das Nutzen von 2 übereinander liegenden Schichten auf ca.
8,5 GB erhöhen. Man kann auch durch beide Seiten der Disk
die Kapazität (bei einer Schicht pro Seite) verdoppeln,
b.z.w. beim Verwenden beider Möglichkeiten fast
vervierfachen auf ca. 17 GB. Bei HD-DVD sind einlagig 15
und weilagig 30 GB möglich. Und die Standard-BluRay kann
zweilagig bis zu 50 GB, die UHD-BluRay sogar 100 GB
speichern.
Auf einer 8,5 GB-DVD (eine Seite, zwei Schichten) passen
z.B. bei 5 Audio-Kanälen mit je 24 Bit, 96 kHz
unkomprimiert (PCM) mehr als 100 Minuten Musik!
Ob nun DVD-Audio oder SACD? Während sich DVD-A-Daten über
die digitale Standardschnittstelle S/P-DIF (dank PCM)
übertragen lassen, gibt es so etwas für das SA-CD-System
nicht.
Beide Systeme sind der CD klanglich weit voraus,
allerdings ist nicht feststellbar, welches besser klingt.
Bis jetzt scheint das DVD-A-System dem SA-CD überlegen zu
sein, dank variabler Video-Nutzung und einfachere
Handhabung beim Studio-Mastering (PCM!). Also ist das mein
klarer Favorit.
Meine Meinung zu MP3:
Bitte das folgende nicht als Hetze gegen MP3 verstehen, ich nutze auch MP3, vor allem im Auto bei Datenraten von meist 192 kbps. Eine Original-CD kann es aber nie ersetzen. Die sollten aber daheim und nicht im Auto liegen!Ich habe die Qualität getestet, mit guten Aufnahmen (z.B.
nur Madonna-Singles oder bestimmten Synthesizer-Songs von
J. M. Jarre) ist der Unterschied eindeutig hörbar, auch
bei Anlagen unter dem Tausend Euro-Bereich und bei
geringeren Kompressionsraten, wie z.B. 192 kb/s. Man
merkt aber deutlich den klanglichen Anstieg bei größer
werdenden Datenraten und aufwendigeren Algorithmen
(quality). Allerdings gibt es auch klangliche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Algorithmen. Dies sind aber
heute nicht mehr so groß, wie LAME und der
Original-Fraunhofer-Codierung belegen.
Ich habe es mit jemandem, der "klanglich unerfahrenen"
(Sorry, dass ich Dich so nenne, A.!) ist, getestet und er
hörte den Unterschied ebenfalls sofort auf einem
Ghetto-Blaster (!) bei 128kb/s. Denn dieser Algorithmus
speichert nicht den Verlauf des Signals, sondern enthält
Beschreibungen, welche Charakteristika das Signal enthält,
so gibt es bei einem Musiksignal auf jeden Fall
Abweichungen.
Praktisch heißt das: 128 kb/s oder weniger ist
inakzeptabel, 192 kb/s ist von der Qualität (abhängig
von der Musik) her meist voll OK und ideal fürs Auto,
256 kb/s würde ich als optimalen Kompromiss bezeichnen,
da bei üblicher Musik die Unterschiede sehr gering sind.
320 kb/s verbessert das ganze noch einmal und kommt dem
Original hörmäßig zu 99,9% nahe.
Als Codec empfehle ich heute guten Gewissens LAME. (mit
max. Quality)
Dazu noch eine Ergänzung: Ich untersuchte nicht, was
besser oder schlechter klingt, sondern ob irgendwelche,
kleinste Unterschiede im A/B-Vergleich hörbar waren. Im
Einzelfall kann es sogar dazu kommen, dass die
komprimierte Fassung empfunden besser klingt als das
Original, da einige unharmonische Töne etwas verweichlicht
werden.
Während bei üblicher "Popmusik", die intensitätsbezogen im
Studio abgemischt wird, Phasendifferenzen fast egal sind,
wirkt sich der Verlust dieser bei Dolby-Surround-codierter
Quellen verheerend aus, da über Phasenunterschiede vor
allem die Amplitude des hinteren Kanals definiert wird.
Auch gibt es starke Unterschiede bei der Klangqualität,
was das Ausgangsmaterial angeht. Bei der Komprimierung von
Titeln, die von analogem Ausgangsmaterial stammten,
stellte ich fest, dass hier auch bei 192 kbps noch
deutliche Einbußen hörbar waren, bei originalen CD-Kopien
war das nicht der Fall. Analoge Aufnahme mit kleinem
Rauschen etc. irritieren anscheinend des Algorithmus
etwas, so dass er nicht richtig effektiv arbeiten kann.
Ich habe es mit der minimalen Kompressionsrate 4,4 (320
kb/s) getestet, diese überzeugt voll.
Mit AAC sieht es etwas besser als bei MP3 aus, hier
genügen 128 kbps für anständige Qualität.
Ein Audiokomprimierverfahren ist praktisch nur sinnvoll,
wenn man viele Daten einsparen kann. Das ist aber nicht
ohne klangliche (hörbare) Verluste möglich, was leider oft
abgestritten wird. Man versucht Sachen zu filtern, die
angeblich das menschliche Ohr nicht wahrnimmt. Aber nicht
jedes Ohr ist gleich, und es lässt sich manchmal nur
schwer überlisten.
Das gilt ebenso für ATRAC (320kb/s) und andere
Komprimiererverfahren. Die zusammengedrückten Daten haben
teilweise auch eine niedrigere Samplingrate wie z.B. im
Satelliten-Radio : Also nichts mit "CD-Qualität"!
Den digitalen Radio-Nachfolger DAB (Digital Audio
Broadcasting) habe ich noch nicht gehört. Er soll aber
laut Stereoplay bei guter Antenne dem UKW-Signal überlegen
sein.
Manche Leute glauben anscheinend tatsächlich, dass
"digital" immer "CD-Qualität" bedeutet und das digitale
Quellen nicht rauschen. Digitale Fehler zeichnen sich aber
nun mal anders aus als analoge!
Bei Mehrkanalsystemen sieht es mit der Kompression etwas
günstiger aus, da man mit Zunahme der Kanalanzahl besser
komprimieren kann. Das liegt u.a. daran, dass meistens
mehrere Kanäle ähnliche Informationen enthalten, wie z.B.
die drei Frontkanäle. So lassen sich durch aufwendige
Korrelation bessere Kompressionsraten erzeugen, bei
geringem Klangverlust. Aber auch hier sollte die starke
Komprimierung den Filmen vorbehalten bleiben, bei denen
sie durch die große Datenmenge (2 Stunden Lauflänge)
sinnvoll ist.
Some articles are in english too. click here for a list.